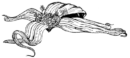Otis Steinbach (Hg.)
„Es ist eben der Kampf des Unterdrückten gegen den Unterdrücker“.
Arnold Lequis’ koloniale Ego-Dokumente aus China / Japan 1900/01 und
Deutsch-Südwestafrika 1904/05
Quellen zur Kolonialgeschichte, Band 14
Broschur, 15 x 21 cm, 290 Seiten,
25 Abbildungen,
Bochum, September 2025
ISBN 978-3-939886-17-4
32,80 EUR


Einleitung
Viktor Arnold Lequis, geboren am 2. Februar 1861 in Dillenburg, begann seine Militärkarriere als Fahnenjunker im Pionier-Bataillon Nr. 8, dem er im Alter von 19 Jahren beigetreten war. Im Oktober 1881 avancierte er zum Sekondeleutnant. In der Beurteilung des Bataillons-Kommandeurs hieß es, Lequis sei „ein charakterfester, sehr befähigter, fleißiger, energischer und frischer Offizier“, dessen Benehmen sich durch Bescheidenheit und Takt auszeichne. Bis 1896 stieg Lequis zunächst zum Adjutanten des Bataillons, dann zum Premierleutnant und schließlich zum Hauptmann auf. Am 1.4.1898 wurde er in den Großen Generalstab berufen; ein Jahr später versah er seinen Dienst als Kompaniechef beim 7. Pionier-Bataillon in Deutz.
Seine erste Kriegserfahrung sollte Lequis im Jahre 1900 sammeln: Als Führer der 1. Kompanie des Ostasiatischen Pionierbataillons nahm er an der Niederschlagung der Boxerbewegung in China teil. Abgerundet wurde dieser offenbar wenig gefahrvolle Auslandseinsatz durch einen längeren Erholungsurlaub in Japan, dem Ende Juni 1901 beinahe unverzüglich die Heimreise folgte. Eine Vielzahl von Briefen und Ansichtspostkarten, die Lequis in dieser Zeit an seine Eltern richtete, ist heute im Bundesarchiv zugänglich; sie bildet den ersten Teil dieses Buches. Während der China-Expedition soll sich Lequis „als ungewöhnlich tüchtiger Feldsoldat von großer Energie und weitem Blick“ bewährt und sich „durch große Unternehmungslust“ hervorgetan haben. Erwartungsgemäß erfolgte dann am 12. September 1902 seine Beförderung zum Major, der sich eine verhältnismäßig kurze Lehrtätigkeit an der Kriegsakademie anschloss.
Mitte 1904 war Lequis dann erneut an einem Kolonialkrieg beteiligt, diesmal in Deutsch-Südwestafrika, wo er in seiner Funktion als Generalstabsoffizier des Etappenkommandos am Feldzug gegen die Herero (später auch gegen die Nama) teilnahm. Hier verfasste Lequis nicht nur Briefe, sondern auch tagebuchartige Aufzeichnungen sowie Abschriften von Berichten, Meldungen und Telegrammen, die ebenfalls zum größten Teil archivalisch erhalten sind und den zweiten Teil dieses Buches ausmachen. Durch chronische Verdauungsbeschwerden heimsendungsbedürftig geworden, verließ Lequis im Januar 1905 die Kolonie, dabei jedoch den Umweg über das östliche Afrika und Italien nehmend, denn, so schreibt er an seinen Vater, „so bald wir einem solche Gelegenheit etwas zu sehen nicht wieder geboten.“
Lequis’ illustrer militärischer Werdegang erreichte im Ersten Weltkrieg seinen Höhepunkt: In der Zwischenzeit zum Generalmajor und schließlich zum Generalleutnant befördert, fand er hier Verwendung unter anderem als Divisionskommandeur. Lequis nahm an einer Vielzahl von Kämpfen teil, darunter die Schlacht an der Somme 1916, die Zwölfte Izonzoschlacht 1917 und die Frühjahrsoffensive 1918. Für seine besonderen Leistungen erhielt er mehrere Militär-Verdienst-Orden verliehen, so etwa den pour le Mérite mit Eichenlaub und den Königlichen Kronenorden 2. Klasse mit Stern und Schwertern.
Dieser schillernden Karriere folgte nach Ausrufung der Republik ein allmählicher Abstieg, der mit den Berliner Weihnachtsunruhen 1918 seinen Anfang nahm. Als im Dezember meuternde Marinesoldaten das Berliner Stadtschloss und den Neuen Marstall besetzten, um dem Staat die Auszahlung ihres Soldes abzupressen, übernahm Lequis den Befehl über das Generalkommando, welches zum Schutz der neuen Regierung in der Hauptstadt eingerichtet worden war. Doch wegen unzureichender Kräfte – und weil die Berliner Zivilbevölkerung plötzlich in die Auseinandersetzungen eingriff – misslang ihm die gewaltsame Niederschlagung des sogenannten Weihnachtsaufstands. Infolge des missglückten Unterfangens sei Lequis dann „sofort geopfert und durch den General v. Lüttwitz ersetzt“ worden, der kurz darauf den Januaraufstand der Spartakisten niederringen sollte.
Mitte 1919 übernahm Lequis das Kommando über die Reichswehrbrigade 8 und wurde damit zum Führer im Grenzschutz Oberschlesiens. Am 20. März 1920 wurde er mit der Liquidierung des Kapp-Putsches in Schlesien betraut, an dem er sich nicht beteiligt hatte und dessen Scheitern er voraussah. „Der Kapp-Putsch war eben damals ein widersinniger Versuch am untauglichen Objekt“, urteilte Lequis viele Jahre später. Als Liquidator hatte er sich bemüht, Ruhe und Ordnung möglichst ohne Blutvergießen wiederherzustellen, dabei jedoch einen schweren Stand gehabt. Teile des Militärs waren bereits auf den Staatsstreich hereingefallen, sodass sich Lequis zunächst nur auf seine eigene Reichswehrbrigade in Brieg (heute das polnische Brzeg) verlassen konnte. Doch auch die Arbeiterschaft und die Zivilbehörden hatte Lequis gegen sich, da diese ein energischeres Einschreiten gegen die Putschisten, die Auflösung der Freikorps sowie eine umfassende Volksbewaffnung forderten. Der Reichswehrminister gewann in Berlin schließlich den Eindruck, dass Lequis „den schwierigen Verhältnissen in Breslau nicht mehr gewachsen“ gewesen sei und die nötige „klare Haltung“ habe vermissen lassen. Obwohl sich die Wogen in Schlesien durch dessen umsichtiges Vorgehen bereits zu glätten begannen, wurde der Generalleutnant deshalb Ende März unter Enthebung seiner bisherigen Verwendungen auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Lequis, der dies als tiefe Ehrverletzung empfand, reichte noch im selben Jahr sein Abschiedsgesuch ein. Am 18. Dezember 1920 wurde ihm noch ehrenhalber der Charakter eines Generals der Infanterie verliehen, nachdem er bereits endgültig aus dem Militärdienst ausgeschieden war.
Erst im hohen Alter von 65 Jahren heiratete Arnold Lequis seine Frau Erna (geboren Pelzer) und zog mit ihr auf ärztlichen Rat 1926 ins süd-tirolische Meran, wo sich das Höhenklima begünstigend auf die Gesundheit des Kriegsgeschädigten auswirken sollte. Akute Geldnot zwang das Paar 1935 zur Rückkehr nach Deutschland, wo es sich auf der Adolfshöhe bei Wiesbaden niederließ. Die hohen Krankheits- und Aufenthaltskosten, Familienunterstützungen sowie starke Pensionskürzungen hatten ihr Vermögen auf einen Geldwert von lediglich 6.200 Mark schrumpfen lassen, sodass Arnold Lequis sich genötigt sah, eine zusätzliche Kannpension für seine Ehefrau zu beantragen.
Weder in der Weimarer Republik noch im NS-Staat scheint sich Lequis politisch oder anderweitig besonders betätigt zu haben, mit Ausnahme verschiedener Vereinsmitgliedschaften, die heute nachweisbar sind. So war er beispielsweise Mitglied des Ehrenausschusses im Reichsbund Deutscher Eisenbahner-Kriegsteilnehmer. Des Weiteren trat er 1938 dem Nationalsozialistischen Reichskriegerbund „Kyffhäuser“ bei. Am 16. Februar 1949 verstarb Arnold Lequis im Alter von 88 Jahren. Über etwaige leibliche Nachkommen ist nichts bekannt; im Jahr 1938 jedenfalls war die Ehe kinderlos gewesen. Die Witwe übergab den schriftlichen Nachlass ihres verstorbenen Ehegatten 1956 dem Bundesarchiv, wo er noch heute aufbewahrt wird und ohne besondere Benutzungsbedingungen eingesehen werden kann.
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind ausschließlich diejenigen Ego-Dokumente und Privatakten, die einen Einblick in Lequis’ Tätigkeit auf kolonialen Kriegsschauplätzen gewähren. Diese Auswahl ermöglicht einen interessanten historischen Vergleich zwischen der Intervention in China und dem zeitlich nachgelagerten Kolonialkrieg in Südwestafrika. Sie gestattet es, Parallelen, aber auch Unterschiede in der Kriegsführung herauszuarbeiten. Thematisch lassen sich Lequis’ Aufzeichnungen in drei Bereiche unterteilen, die im Folgenden kurz angerissen werden sollen.
Gesundheit, Heimat und Familie
Obwohl Arnold Lequis sich freiwillig für die Einsätze in China und Südwestafrika gemeldet hatte, wurde er dort recht bald heimwehkrank. Offenbar hatte er den Dienst im Ausland als günstige Gelegenheit gesehen, die Karriereleiter schneller zu erklimmen, doch einmal angekommen, schien er von der wenig kriegerischen Art seiner Tätigkeit kaum begeistert zu sein. „Am liebsten gingen wir glaube ich alle wieder nach Hause“, schreibt Lequis weniger als zwei Monate nach seiner Ankunft in China an seine Eltern. Auch in Deutsch-Südwest hatte er bald „keinen rechten Spaß mehr an der Sache.“ Gesundheitliche Beschwerden boten in beiden Fällen einen willkommenen Anlass, um sich frühzeitig vom Kriegsschauplatz zu entfernen. In China litt Lequis an einer Hautpilzerkrankung, die ihm einen achtwöchentlichen Kururlaub in Japan eintrug. In Südwestafrika stellte sich chronische Blutruhr ein. Besorgt war Arnold jedoch vor allem um die Gesundheit seiner Familie zu Hause, besonders die seiner Mutter Gertrud (geboren Pütz). Kurz vor der Abfahrt ihres Sohnes nach China wurde bei ihr eine „Anschwellung der Gedärme“ diagnostiziert. Immer wieder erkundigte sich Arnold daher in seinen Briefen nach ihrem Befinden. Erfreulicherweise durfte Gertrud die Wiederkehr ihres ältesten Sohnes noch erleben, doch im Frühjahr 1902 verschied sie schließlich nach langer Krankheit. Arnolds Briefe aus Deutsch-Südwestafrika waren dementsprechend nur noch an seinen Vater, Joseph Lequis, addressiert.
In den Briefen finden auch die Geschwister Elise, Willi und Kurt vielfach Erwähnung, des Weiteren Verwandte wie Onkel Mathias Pütz. Die innerfamiliären Angelegenheiten, die dort besprochen wurden, sind heute zum großen Teil nicht mehr rekonstruier- und nachvollziehbar, sie unterstreichen jedoch einmal mehr, welch hohen Stellenwert das Familienleben für Arnold Lequis einnahm. Oft ging es auch um rein praktische Angelegenheiten, wie zum Beispiel Möglichkeiten des Austausches, Paketsendungen und Zollprobleme, Erledigungen in der Heimat und so weiter und so fort.
Der Tod seines jüngeren Bruders, Ernst, stellt eine besonders tragische Episode dar, die in Arnold Lequis’ Briefen verarbeitet wird. Während in China der Boxerkrieg tobte, war Ernst gerade als Offizier der Schutztruppe in Kamerun tätig. Am 7. Dezember 1900 wurde er bei einem Scharmützel mit aufständischen Weyjambassa im Yaunde-Distrikt durch Kopfschuss getötet. Als Arnold davon erfuhr, wandte er sich voll Kummer und Zorn an seine Eltern: „Wenn ich hier fertig bin, möchte ich mich dorthin versetzen lassen, und dann sollen Tausende bluten, wo Ernst sein Leben hat lassen müssen.“ Seine Karriere als Schutztruppenoffizier sollte ihn 1909 tatsächlich einmal nach Kamerun führen. Ein Tagebuch, Bilder und Privatakten aus dieser Zeit sind ebenfalls im Nachlass enthalten, sie können jedoch allein schon aus Platzgründen keinen Bestandteil dieser Veröffentlichung bilden.
Der Etappendienst
Weder in China noch in Südwestafrika war Arnold Lequis an Gefechten beteiligt. Stattdessen war er in erster Linie im Etappenwesen beschäftigt, das heißt, seine Tätigkeit beschränkte sich vor allem auf die Leitung von Wege- und Bauarbeiten sowie auf das Landen und die Inmarschsetzung von Truppentransporten. Mehr noch als die Briefe bieten die südwestafrikanischen Tagebuchblätter und Akten einen Einblick in den Alltag der Etappe während des Kolonialkrieges. Sie lassen erst erkennen, welch ungeheure Anstrengungen unternommen werden mussten, um den Nachschub und damit den Krieg überhaupt am Laufen zu halten. Dieser Aspekt kolonialer Kriegsführung ist bislang auffallend wenig beleuchtet worden, obwohl ein Großteil der deutschen Streitmacht in Südwest nur für Etappenzwecke verwendet wurde.
In Deutsch-Südwestafrika sah sich Lequis vor die komplizierte Aufgabe gestellt, den nötigen „Massenbetrieb mit den primitivsten Mitteln“ zu bewerkstelligen, wie er selbst nach Hause schrieb. Nicht selten musste er sich gegen andere Offiziere, gegen Zivilbehörden und gegen die Landungsgesellschaften behaupten, die seinen Maßnahmen zur Steigerung von Verkehr und Landungsbetrieb skeptisch gegenüberstanden. Bei dieser Aufgabe scheint Lequis nicht nur nach seiner eigenen Darstellung großes Durchsetzungs- und Improvisationsvermögen bewiesen zu haben. Generalleutnant von Trotha hatte sein Talent offenbar früh erkannt und ihn in Swakopmund festgesetzt, wo er den Dienstbetrieb der so wichtigen Etappe persönlich zu leiten hatte. Als schließlich auch die Nama der deutschen Kolonialmacht den Krieg erklärten, wurde Lequis zur Einrichtung der südlichen Etappenlinie nach Lüderitzbucht und zur Materialbeschaffung nach Kapstadt gesandt. Nachdem er 1905 dem Schutzgebiet den Rücken gekehrt hatte, soll Trotha über ihn geäußert haben: „Er war der richtige Mann am richtigen Platz und hat mir durch seine Energie und durch sein praktisches Verständnis die größten Dienste geleistet.“
Lequis’ Urteil über seine Vorgesetzten fiel weniger positiv aus. Während beider Kolonialkriege warf er ihnen eine Missachtung des Etappendienstes, Geltungssucht sowie starres Schablonendenken und Schematismus vor. Er ärgerte sich über die monotonen technischen und organisatorischen Arbeiten, die ihm weder Zeitungsruhm noch Verdienstorden einbrachten. Dieser Frust konnte bisweilen auch in Neid umschlagen, etwa als ihm in China der Sturm auf die Peitang-Forts verwehrt blieb, anders als seinem Kollegen von der zweiten Kompanie. „Aber so geht’s im Leben: ich arbeite feste und werde sehr geschätzt, der andere thut nichts, ruft einmal Hurrah und wird zum russischen und preußischen Orden eingegeben.“
Gewalt, Fremdwahrnehmung und Ideologie
Arnold Lequis hatte bei der Verabschiedung des Ostasiatischen Expeditionskorps am 27. Juli 1900 in Bremerhaven die sogenannte „Hunnenrede“ des Kaisers hautnah miterleben können. Der oberste Befehlshaber hatte seine Soldaten dazu aufgefordert, rücksichtslos gegen die chinesischen Feinde vorzugehen und dabei dem Vorbild der Hunnen zu folgen. Lequis’ Briefe zeigen, dass die Truppe diese Aufforderung nicht nur ernstnahm, sondern sogar hoffte, sie übererfüllen zu können. „Imponieren thut dem Chinesenpack nur roheste Brutalität, alles andere ist Schwäche“, schreibt Lequis noch während der Hinfahrt an seine Eltern.
Gleichwohl verweisen die Briefe auf eine gewisse Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, denn die exzessiven Gewaltfantasien der Soldaten ließen sich vor Ort nicht ungehemmt in die Tat umsetzen. Tatsächlich werde den Männern mächtig auf die Finger geschaut, Plünderung und Misshandlung geahndet, schreibt Lequis. Nur ein einziges Mal nahm er persönlich an einer Strafexpedition teil. Zwar wurden dabei ganze Dörfer mit brachialen Kollektivstrafen belegt, einen Hunnensturm mit Tod und Verwüstung schildert Lequis jedoch nicht. Bereits im Januar 1901 soll es in China „zahmer als in Deutschland“ gewesen sein, sehr zum Leidwesen der Truppe, die mit ganz anderen Erwartungen in das Reich der Mitte gekommen war. Allerdings zeigen die Briefe auch, wie beinahe alltäglich von der Prügelstrafe Gebrauch gemacht wurde. Faulenzende Arbeiter erhielten stets eine „Aufmunterung“, Diebe sogleich „25 auf die Badehose“ und überhaupt müsse man in China „immer deutlich mit Stock oder Reitgerte reden“, so Lequis. Die grassierende Hehlerei mit chinesischen Kunst- und Kulturobjekten suchte er in seinen Briefen nicht zu verheimlichen, vielmehr beteiligte er sich selbst lebhaft an dem Raubhandel, ohne auch nur den mindesten Schein von Reue zu heucheln. Am Ende kehrte Lequis mit „14 mehr oder weniger große[n] Kisten“ für seine neue „chinesisch-japanische Wohnung“ in die Heimat zurück.
Die kriegerische Gewalt gegen die afrikanische Bevölkerung Deutsch-Südwestafrikas wiederum bildet in den Nachlassunterlagen des Generals eine auffallende Leerstelle. Dies hängt wohl vor allem damit zusammen, dass Lequis die sicheren Küstenorte Lüderitzbucht und Swakopmund nur selten verließ, und dann auch nur zur vorübergehenden Bereisung der ebenfalls ungefährdeten Etappenstraßen und Bahnlinien. Die telegrafischen Meldungen, die ihn laufend über den Fortgang der Operationen im Inneren orientierten, ließen das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe in der Omaheke-Halbwüste offenbar kaum erahnen. So schrieb Lequis Ende September 1904 in völliger Verkennung der Lage an seinen Vater, die Herero säßen in einigen Tagen „quietschvergnügt auf englischem Gebiet“, um von dort die Kriegsfackel bald wieder in die deutsche Kolonie hineinzutragen. In seinen späteren Notizen heißt es dazu knapp, man habe damals „noch keinen rechten Überblick über das Ergebnis des Marsches der Hereros durch die Omaheke“ gehabt. An der Einrichtung der Konzentrationslager war Lequis nicht mehr beteiligt. Allerdings hatte er zuvor auf die Gestellung von Kriegsgefangenen hingewirkt, um den Arbeitskräftemangel im Landungsbetrieb abzumildern.
Die fehlende Fronterfahrung mag erklären, weshalb die Herero und Nama in Lequis’ südwestafrikanischen Tagebüchern so merkwürdig unsichtbar bleiben. Über Chinesen jedoch, mit denen er öfters in Kontakt kam, häuft er in seinen Briefen deutliche Worte der Abscheu. Sie seien ein „Schweinevolk“ und „höllisch feige“. Aber auch Sparsamkeit und Geschäftssinn sagt er ihnen nach. Ferner geben die Briefe Aufschluss darüber, welchen Eindruck Lequis von seinen Bundesgenossen in China gewann, Russen, Franzosen, Italienern, Engländern und Amerikanern. Dabei kommen immer wieder anglophile Tendenzen zum Vorschein. Lequis bewunderte die Kolonialpolitik der Briten und stellte sie wiederholt als vorbildlich für Deutschland heraus. Besonders wertvoll sind auch seine Anschauungen der japanischen Mentalität und Lebensweise, die er bei seiner Urlaubsreise in dem Inselreich etwas näher hatte kennenlernen dürfen.
Obwohl sich Lequis regelmäßig rassistischer Stereotype bediente, ist bei ihm keine Spur einer Ideologisierung der Kolonialkriege im Sinne eines exterminatorischen „Rassenkampfes“ zu erkennen. Dies passt auch zu seinem Werdegang insgesamt, bei dem er „sich vom jungen Offizier an […] nicht weiter um Politik gekümmert“, sondern sich stattdessen ganz „seinem Dienst und dem Aufstieg durch den Generalstab“ verschrieben hatte. Auch von einer voranschreitenden Radikalisierung kann bei Lequis keine Rede sein, eher im Gegenteil. Hatte er sich in China noch für ein Primat des Militärischen über die Diplomatie ausgesprochen, so mahnte er nach dem Krieg in Südwestafrika, „bei rechter Zeit an’s Ende zu denken und den Bogen nicht [zu] überspannen“. Militärhistoriker:innen wie Susanne Kuß haben argumentiert, China sei ein Experimentierfeld für Vernichtungskriegführung gewesen, die dann in Südwestafrika rassenideologisch begründet und zum Genozid gesteigert worden sei. Lequis’ Nachlassunterlagen, die auf der Mikroebene einen Einblick in das Denken und Handeln eines Kriegsteilnehmers gewähren, lassen Zweifel im wenigsten an der Verallgemeinerbarkeit dieser Interpretation aufkommen.
Editorische Hinweise
Insgesamt wurden für diese Edition acht Aktenbände des Militärarchivs Freiburg mit zusammen über 1.600 Seiten herangezogen. Drei dieser Bände enthalten die Privatkorrespondenz zwischen Arnold Lequis und seinem Vater Joseph. Ein weiterer Aktenband birgt die Urschrift der südwestafrikanischen Kriegstagebücher. Darin verweist Lequis immer wieder auf seine Privatakten, also auf Abschriften von Berichten und Telegrammen, die er zur Auffrischung seines Gedächtnisses behalten wollte. Der größte Teil dieser Anlagen befindet sich in drei verschiedenen Aktenbänden, die ebenfalls in Freiburg archiviert sind. Wo sich Verbindungen zwischen den Inhalten der Tagebücher und den Sachakten herstellen ließen, wurden Letztere ergänzend in den Anhang dieses Buches aufgenommen. Teilweise konnten die Anlagen, auf die sich Lequis im Text bezieht, jedoch nicht ermittelt werden. Vor allem die Akten über seine erste Landung in Lüderitzbucht Mitte 1904 scheinen nicht erhalten zu sein. Lequis erwähnt selbst, er habe keine Abschriften seiner Befehle und Berichte aus jener Zeit angefertigt, stattdessen befänden sich diese in einem – heute wohl verschollenen – Aktenstück der Etappe Süd. Dem Text beigefügt ist außerdem noch eine Reihe von Abbildungen, darunter auch eine Handvoll Fotografien aus China.[15] Bei der mangelhaften Bildqualität schien sich leider nur ein kleiner Teil davon für eine Veröffentlichung anzubieten.
Die vorliegende Transkription bewahrt orthografische Fehler sowie Eigenheiten bei der Schreibung von Ortsnamen. Um den Lesefluss zu verbessern, wurden jedoch in bestimmten Fällen kleinere, nicht besonders gekennzeichnete Anpassungen an der Interpunktion vorgenommen. Da Lequis’ Groß- und Kleinschreibung eher angedeutet als deutlich ist, wurde hier durchgängig die korrekte Schreibweise gewählt. All jene Wörter, deren Transkription unsicher ist, sind mit einem eckig umrahmten Fragezeichen [?] versehen. Auslassungen, die durch unleserliche Stellen im Text zustande kommen, werden durch eine eckige Klammer mit drei Punkten und einem Fragezeichen angezeigt […?]. Die südwestafrikanischen Briefe sind chronologisch in das Brief-Tagebuch einsortiert, wobei der Anfang eines jeden Briefes leicht durch den Titel, sein Ende durch die Markierung *** kenntlich gemacht ist.
Aus dem Inhalt
Nun einiges von Peking: Vorigen Montag 10° v. reiste ich mit Hauptmann Adams, unserem Hauptmann vom Stabe, mit der Bahn ab. Zu unserem Bedarf hatten wir uns reichlich mit Decken und Futter versehen, auch 5 Ponys als Fortbewegungsmittel für uns, unsern Dolmetscher, Pferdehalter und Packpferd mitgenommen. In Peking sind die Wege sehr weit und Pferde äußerst nöthig. Um 4 ½ nachmittags kamen wir nach langweiliger Fahrt durch eintöniges Flachland in der Kaiserstadt an und wurden hier von Hauptmann Klehmet der Marine-Pionier-Kompagnie empfangen. Die Eisenbahn fährt jetzt durch eine Bresche der Stadtmauern in die Stadt selbst ein, während früher der Bhf ½ Stunde vor der Stadt lag und eine elektrische Bahn zur Stadt führte. Spaßig ist’s, daß die Franzosen die Bahn, welche von Paotingfu nach Peking geht, mit einem besonderen Geleise an ganz anderer Stelle in die Stadt führen, trotzdem ihre Bahn schon auf der vorletzten Station an unsere Bahn anstößt. Aber die Engländer hatten ja das letzte Stück der Bahn Tientsin-Peking wiederhergestellt und die englische Gesellschaft, der diese Bahn gehört, wird wahrscheinlich bald deren Betrieb von uns übernehmen. Und auf die Engländer sind Franzosen und Russen wie der Truthahn oder der Stier auf den rothen Lappen. Spaßig sind überhaupt die verschiedenen Nationen in ihrem Verkehr und in ihrem Sprechen übereinander. Die Engländer sind fast durchweg wenig gelitten und warum? Es sind vornehme ruhige Gentlemen (ich meine natürlich nur die Offiziere und besseren Kaufleute), sie fallen Einem nicht um den Hals wie die Russen, Franzosen und Italiener, sie versprechen nichts, was sie nicht halten, wie die Russen, sie haben einen kurzen einfachen Gruß für Leute, die sie nicht kennen; sie saufen nicht wie die Russen und Deutschen, sondern treiben in ihrer freien Zeit viel körperlichen Sport und somit gelten sie für stolz und zurückhaltend, während sie meiner Ansicht nach Männer sind, deren Körper und Denken sich in ruhigem Gleichgewicht befindet. Natürlich ihre Soldaten sind entweder Rauf- und Trunkenbolde, soweit es Engländer sind, oder Heiden, die natürlich mit europäischen Truppen [nicht?] konkurrieren können, aber für Kolonialzwecke voll genügen. Jedenfalls machen die Shiks einen ganz verständigen militärischen Eindruck und sind die englischen Offiziere ganz mit ihnen zufrieden. – Von Russen haben wir jetzt nur sehr wenig mehr hier, doch wollten die Offiziere von den Franzosen nichts wissen und halten sie für schlechte Soldaten; ihre persönlichen Sympathien sind bei uns, während sie über unsere Politik schimpfen. Trotz aller Sympathien aber hauen sie uns über die Ohren, wo sie nur können und wenn sie etwas an uns übergeben, wie zb. die Bahn Yangtsun-Shanheikwan, ist alles was nur irgend abzuschleppen ist, mitgewandert; so wurden zb. alle gepolsterten Bänke der ersten Klasse mitgenommen, sodaß man in den letzten Tagen des russischen Betriebs sich in vielen […?] nicht setzen konnte. Dabei nehmen sie nicht nur mit, was in ihrem Besitz war, sondern alles was auf einigen Kilometern im Umkreise noch vorhanden ist. Im Nehmen ist ja im Allgemeinen keiner schüchtern, aber der eine verstehts doch besser wie der andere und da haben […?] doch die Engländer und Russen besseres Verständniß. Da wird einfach gehandelt und weder hier noch zu Hause Gerede gemacht. Wir schreien hier wie zu Hause und dabei sind wir so spät gekommen, daß etwas wesentlich Werthvolles nicht mehr zu bekommen war. Aber so ein braver Musketier, der sich einmal eine Altardecke oder -vorhang oder sonst etwas hier nimmt; gleich wird er wegen Plünderung gerichtlich schwer bestraft. Für einen Soldaten ist es wirklich kein Vergnügen dem deutschen Volke seine Dienste hergeben zu müssen, wo gar kein Verständniß vorhanden ist, daß unterjochte Völker nach ihrer eigenen Auffassung behandelt werden müssen und nicht nach dem deutschen Strafgesetzbuch. Kommt doch soeben ein Unteroffizier zu mir und beklagt sich, daß er Vorwürfe bei Gericht bekommen, weil er einem in der Nacht Holz stehlenden Kuli nicht auf Chinesisch zugerufen habe. Als ob wir 1870 in Frankreich auf Posten stets französisch, qui vive und dergleichen gerufen hätten. Werden hier sogar Leute, die sich Flaschen Wein stehlen, wegen schweren Diebstahls bestraft, während das Gesetz dieses bei Genußmitteln nicht kennt. Na unsere Leute haben die Sache auch dicke satt und vom ganzen Expeditionskorps hat sich kein Mann zur weiteren Kapitulation gemeldet. Alles will nach Hause, nicht weils da so schön ist, sondern weil ihnen hier das Leben verekelt wird. Schreiben sie die geschnurrten Briefe nach Hause, so werden sie gerichtlich gefaßt, nehmen sie sich irgendwo ein Andenken mit, so ist die Plünderung fertig, treten sie einem unverschämten Chinesen vor den Bauch, so ist Mißhandlung zu ahnden. So leicht bekommen wir eine Armee für irgendwelche überseeischen Zwecke nicht wieder zusammen. Wenn hier auch kein Krieg ist, so hat die Gesundheit doch hier manchen Knacks zu erleiden und umsonst sind von meinen 220 Mann nicht stets 30-40 krank. Dafür muß der gemeine Mann aber auch etwas Luft haben und im Krieg muß eben die besiegte Nation darunter leiden. Das verstehen auch die Japaner, die mehr nach Hause geschleppt haben, als ihnen der Krieg gekostet, während wir hier alles brav bezahlen und das 3fach, sodaß gar kein Grund zum Frieden machen insofern vorliegt, als ja ein großer Theil der Millionen in chinesische Taschen fließt. Eine energische Kriegführung nach chinesischem Geschmack: feste Geldstrafen, Köpfen aller Spitzen, Verbrennen aller widerspenstigen Nester würde kein deutscher General riskieren, da er dann bei seiner Rückkehr mit Hülfe des Reichstages ins Gefängniß wandern würde. Wir müssen uns vorläufig mit Kolonien nicht zu sehr abgeben, da wir nicht mit kurzen scharfen Mitteln zu arbeiten verstehen, wir müssen deßhalb bis zu späterer besserer Einsicht unter englischem Schutz unser Geld zu verdienen suchen. Wenn wir dann mit der Zeit etwas mehr von Weltpolitik und ihrer praktischen Handhabung gelernt haben, dann ist auch vielleicht die Zeit unserer überseeischen Selbstständigkeit gekommen. Spassig ist es, daß unsere Kaufleute draussen meist lieber in englischen Kolonien und englischem Schutz ihre deutschen Geschäfte machen. Warum? Weil sie energisch mit Mann und Schiff geschützt werden, ohne viel Tüftelns, ob Recht oder Unrecht. Na, nun scheine ich aber mächtig entgleist zu sein von meinem Thema, das von Peking über die Offizierskorps der verschiedenen Nationen in die hohe Politik sich verirrt hat. Also noch etwas von den Offizieren: Russen sehr liebenswürdig, innerlich wenig vornehm, Halbasiaten, aber brauchbare energische Soldaten, die ihre Mannschaften fest in der Hand haben. Franzosen sehr dankbar für Entgegenkommen, gewandte, adrette Leute, vielfach aber nur äußerlich, während Wohnungen, Offizierkasino oft schmutzig [?]. Mit ihren Kerlen scheinen sie nicht so ganz leicht fertig zu werden, jedenfalls zeichnen diese sich durch Rohheit vor allen anderen aus. Hat man dagegen mit den einzelnen Franzosen zu thun, so selbst der gemeine Mann gewandt und liebenswürdig. Die Russen, die sie im Gefecht gesehen, behaupten, daß sie nur für die Reserve gut gewesen!? Die wenigen Italiener, die hier sind, sind reizende, nette wohlerzogene Kerle und haben wir regen Verkehr mit den Bersaglieri, die allerdings die vornehmsten Offizierkorps haben. Allerdings haben sie insofern französischen Anspruch, als ihr lebhaftes Temperament sie zu Überschwänglichkeiten, ewigen Toasten, Reden reizt; sodaß es eine Erholung ist, wenn man einmal bei Engländern zu Tisch ist. Es wird einmal zugeprostet und dann sich richtig unterhalten. – Also 4 ½ nachmittags in Peking angekommen, wurden wir in unser Quartier, ein chinesisches Haus in dem einige Öfen aufgestellt waren, geführt. Zum Todlachen schön [?] war’s nicht, aber man brauchte es ja nur zum Schlafen, weil wir unsere Mahlzeiten bei der Marine-Pionier-Kompagnie einnahmen. Am anderen Morgen ritten wir sofort zum Kaiserlichen Sommerpalast, etwa 15km vor der Stadt, da das Wetter gerade windstill und ein bekannter Offizier dort dienstlich zu thun hatte. Engländer und Italiener haben dies herrliche Fleckchen Erde besetzt. Beschreiben läßt sich das Alles nicht, wenn nicht meine Photographieen zur Erläuterung dabei liegen. Herrliche Seen mit Inseln, die durch […?] geschwungenen Marmorbrücken mit dem Lande verbunden sind, […?], Tempel, die sich in den herrlichsten Farben zeigen und hier zerstreut, dort zu Gruppen massiert, am Fuße, an den Hängen und auf dem Grat eines etwa 50-100m hohen Gebirgsausläufers dem erstaunten Besucher darbieten. Im Hintergrunde hohes Gebirge, dessen Thäler und Schluchten mit Dörfern, Klöstern, Tempeln übersät sind, dessen niedrigere Kuppen herrliche Pagoden tragen. Steht [?] man aber den Herrlichkeiten zu […?], so ist im Allgemeinen nur das tadellos in Ordnung gehalten, was am inneren kaiserlichen Haushalt genutzt wird, alles Übrige hier wie in ganz China athmet Verfall; soweit es von der Regierung abhängt. Der Privatmann hat natürlich seinen Luxus je nach Vermögen. Die innere Einrichtung aller Paläste pp ist natürlich futsch! Wer sie genommen, keiner weiß; jedenfalls ist es der momentane glückliche Besitzer der Paläste nicht gewesen, es war immer schon einmal einer vor ihm da. Leider wir Deutschen nicht, nicht weil wir zu ehrlich, sondern weil überhaupt zu spät gekommen und dann zuerst nicht an solche Andenken gedacht oder aber zu dumm bei Besetzungen von Städten pp. Nun muß man aber bei alledem bedenken, daß die Chinesen sich ihr eigenes Unglück auch zu Nutze gemacht haben, dh. feste geplündert und gestohlen haben, wo sichs irgend machen ließ, daß der Weg der Boxer wie der chinesischen Soldaten durch Mord, Brand u Raub gekennzeichnet ist. Man weiß also nie genau, wer’s war und das ist ganz gut. Jedenfalls giebts auf den Pekinger Märkten massenhaft gestohlenes und geraubtes Gut von den Chinesen zu kaufen. –